Hamburger Forscher zum Weltklimabericht: „Es wird keine Apokalypse kommen“
Zögern, das war gestern. Jetzt muss gehandelt werden. Dieses und nicht nächstes Jahr, und das weltweit – das ist die Botschaft im Synthesebericht des Weltklimarats (IPCC), der in der Schweiz vorgestellt wurde. Was dort drinsteht, gilt als wissenschaftlich gesetzt – und zwar auf der ganzen Welt. Die Zahlen sind alarmierend. Ein Hamburger Klimaforscher sagt, die Aufgaben sind gigantisch. Aber: Aussterben werden wir nicht.
Der Weltklimarat (IPCC) ist ein Gremium aus 195 Mitgliedsländern, den Bericht haben tausende Forschende acht Jahre lang erarbeitet. „Der Klimawandel ist eine Bedrohung für das menschliche Wohlbefinden und die Gesundheit des Planeten“, heißt es in dem in Interlaken präsentierten Bericht. Die Erwärmung liegt bereits bei rund 1,1 Grad. Fast die Hälfte der Weltbevölkerung, bis zu 3,6 Milliarden Menschen, lebt in Regionen, die besonders starke Folgen des Klimawandels erleben dürften.
Erstmals gibt der Weltklimarat auch eine Vorgabe für 2035: minus 65 Prozent CO2 gegenüber 2019. „Das Tempo und der Umfang der bisherigen Maßnahmen sowie die derzeitigen Pläne sind unzureichend, um den Klimawandel zu bekämpfen“, fassen die Klima-Experten zusammen.
Weltklimarat: 1,5-Grad-Ziel praktisch nicht mehr zu schaffen
Der Weltklimarat erklärt, dass das 1,5-Grad-Ziel praktisch nicht mehr zu schaffen ist. Dafür müssten die weltweiten CO2-Emissionen bis 2030 um 48 Prozent gegenüber 2019 sinken, bis 2035 um 65 Prozent. Tatsächlich zeigt die Kurve nach dem Corona-bedingten Rückgang steil nach oben.
Jochem Marotzke, Direktor des Max-Planck-Instituts für Meteorologie in Hamburg, betonte, selbst eine Begrenzung der Erderwärmung auf unter zwei Grad sei eine gewaltige Aufgabe. Mitautor Oliver Geden von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin sagt: „Mit dem 1,5-Grad-Ziel haben wir uns möglicherweise selbst ein Bein gestellt. Viele denken an ein Kliff: Wenn es darüber hinausgeht, ist alles vorbei.“
Forscher: Größtmögliche Klimaanstrengung ist nötig
Das könne zu Fatalismus führen, nach dem Motto, dann könne man es auch ganz lassen, wenn es eh schon zu spät sei. „Das Klimasystem gerät bei 1,51 Grad nicht außer Kontrolle“, sagt er. Die genaue Gradzahl sei zweitrangig, die größtmögliche Klimaanstrengung sei nötig, weil jedes Zehntel Grad weniger Erwärmung das Risiko von Hitzewellen, Starkniederschlägen und Dürren verringere.
Von Untergangsszenarien hält auch Marotzke nichts: „Es wird keine Apokalypse kommen.“ Das Leben werde gefährlicher, aber dass es auf der Erde gar nicht mehr möglich sein könnte, sei falsch.
Aber: Wenn die Regierungen der Welt die klimaschädlichen Emissionen nicht noch in diesem Jahrzehnt drastisch senken, wird das Leben auf der Erde für kommende Generationen unberechenbarer und gefährlicher. „Wir Wissenschaftler wünschten uns, dass die Kehrtwende im Klimaschutz, aber auch in der Anpassung an die Auswirkungen deutlicher, mutiger und schneller angegangen wird“, sagt Matthias Garschagen.
Forscher: Klimaschutz bedeutet nicht nur Kosten und Herausforderungen
Der Klimaforscher der Ludwig-Maximilians-Universität in München ist Mitautor des Syntheseberichts. „Dass man Kehrtwenden auch zügig hinbekommen kann, hat man jüngst gesehen: Die Welt ist recht erstaunt, wie schnell wir uns beispielsweise von russischem Gas unabhängig machen.“
Garschagen ist es wichtig, dass Klimaschutz nicht nur Kosten und Herausforderungen bedeutet. „Wenn wir beispielsweise Städte umbauen mit mehr Wasser, mehr Begrünung, mehr Beschattung, wenn Gebäude und Dächer begrünt werden, werden sie auch lebenswerter. Oder wenn wir Flächen, auf denen Futtermais für Schweine angebaut wird, in Auenlandschaften verwandeln würden, hätte das auch einen gesellschaftlichen Mehrwert für die Naherholung.“
Das könnte Sie auch interessieren: Milliarden-Projekt U5: Senat wischt Bedenken von Klimabeirat weg
Oliver Geden: „Leider hält sich noch der Reflex: Klimaschutz tut weh. Oder: Wir würden mehr verdienen, wenn wir diese oder jene Maßnahme nicht umsetzten. Aber: Klimaschutz sichert mittelfristig unseren Wohlstand – da muss man hinkommen.“ (miri/dpa)

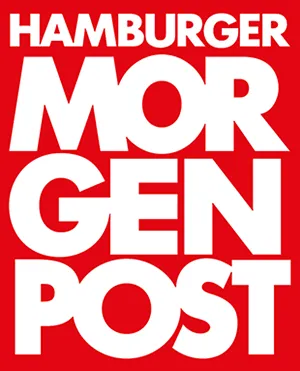

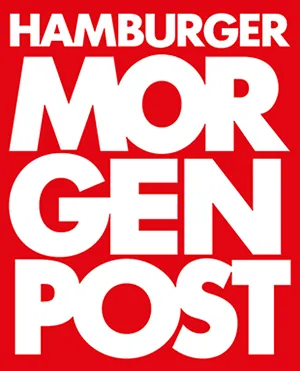
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.