Genetische Daten: Das Geschäft mit Tests zur Abstammung
Die Hoffnung, etwas über die eigene Abstammung zu erfahren, Profisportler als Werbefiguren und „erstaunliche Versprechungen“: Es überrascht kaum, dass weltweit schon fast 50 Millionen Menschen DNA-Tests zur Ahnenforschung gemacht haben. Eine Dokumentation des Fernsehsenders „Arte“ beleuchtet nun allerdings die Kommerzialisierung der genetischen Daten.
Regisseur Olivier Toscer zeichnet in dem anderthalbstündigen Beitrag „DNA-Tests – Das Geschäft mit den Genen“ am Dienstag (20.15 Uhr) ein düsteres Bild über den „vermeintlich amüsanten Trend“. Schon die Herkunftsanalysen auf Basis der selbstgemachten Wangenabstriche seien fragwürdig, die Vorgehensweisen der Anbieter intransparent, lässt er Fachleute erläutern.
Genetiker Paul Verdu etwa erklärt, dass allein bereits die Frage an die Kundinnen und Kunden nach deren Geburtsländern problematisch sei: Das Elsass etwa zählte in der Vergangenheit zeitweise zu Deutschland, zeitweise zu Frankreich.
Medizinische Ungenauigkeiten, mangelnder Datenschutz
Noch viel mehr dürften aber andere Aspekte die Zuschauer und Zuschauerinnen verunsichern: Die Dokumentation geht auch darauf ein, dass mit dem Genmaterial vor allem auch Gesundheitsdaten gesammelt werden.
Zum einen würden diese teils falsch ausgewertet, erklärt der Beitrag. So überprüften die Anbieter nur Teile der Tests auf Fehler. Medizinische Labore nähmen hingegen alle Tests unter die Lupe.
Daten sind interessant für Pharmaindustrie und Krankenkassen
„Die Testanbieter profitieren vom Bedürfnis der Menschen, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen“, sagt eine Stimme aus dem Off. Und spricht von einer „Diagnostikindustrie, die ohne Ärzte auskommt“.
Zum anderen seien die Daten beispielsweise für die Pharmaindustrie und Krankenkassen interessant – gerade in Kombination mit persönlichen Angaben aus einem Fragebogen. Aber auch Banken könnten ein Interesse daran haben. Der US-Finanzinvestor Blackstone zahlte fast fünf Milliarden US-Dollar für die Ahnenforschungs-Plattform Ancestry, wird als Beispiel genannt.
Kontroverse Debatten um Gen-Analysen
Ferner erklärt der Film, dass man in Neuseeland beim Abschluss einer Krankenversicherung offenlegen müsse, ob man schon mal einen solchen Test gemacht hat. In Frankreich wiederum seien private DNA-Tests eigentlich verboten; doch trotzdem boome der Markt auch hier. Und auf Island gab es große Debatten über ein Genomprojekt, wie historische Aufnahmen belegen.
Die Dokumentation geht aber auch darauf ein, was Menschen überhaupt bewegt, solche Tests zu machen: So begleitet die Kamera eine Frau, die weiß, dass sie per Samenspende gezeugt wurde – und nun ihren Vater finden möchte.
Der Kollateralschaden dabei: Über eine der Plattformen findet sie eine Halbschwester. Doch erst über den Kontakt der beiden Frauen erfährt die andere, dass auch sie das Ergebnis einer künstlichen Befruchtung ist.
Anbieter stehen schon länger in der Kritik
Viele der genannten Vorwürfe sind nicht neu. So hatte Ancestry schon 2019 den Negativpreis Big-Brother-Award bekommen. In der Laudatio des ehemaligen Datenschutzbeauftragten des Landes Schleswig-Holstein, Thilo Weichert, heißt es: „Anbieter wie Ancestry missbrauchen das Interesse an Familienforschung, um einen Genom-Schatz für die kommerzielle Forschung anzuhäufen, denn das ist ihr eigentliches Geschäftsmodell.“
Das könnte Sie auch interessieren: Grüne warnen vor noch höheren Krankenkassenbeiträgen
Auch Weichert kommt bei „Arte“ zu Wort. Wer sich über die Risiken informieren möchte, die mit solchen Tests verbunden sind, findet in der Doku ausreichend kritische Ansätze. Wer sich davon nicht beirren lassen will, sollte ausschalten. (dpa/mp)

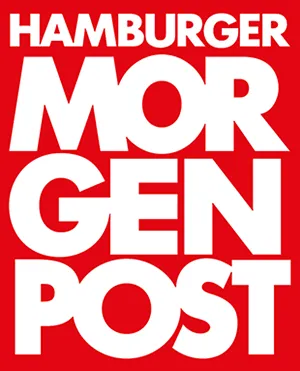

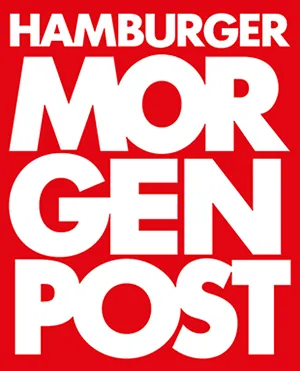
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.