So will der Norden gegen den steigenden Meeresspiegel kämpfen
Mehr als 330.000 Menschen in Schleswig-Holstein leben in überflutungsgefährdeten Gebieten – und der Klimawandel samt Meeresspiegelanstieg birgt Herausforderungen für den Küstenschutz. Der Generalplan Küstenschutz soll Sicherheit für die Zukunft bieten.
Der Blick in die Zukunft beginnt mit einem Rückblick: Fast 60 Jahre ist die verheerende Sturmflut vom 16./17. Februar 1962 her, bei der in Hamburg mehr als 300 Menschen starben und in Schleswig-Holstein die Halligen verwüstet wurden. Von rund 560 Kilometern Seedeichen wurde damals fast die Hälfte entweder zerstört (rund 150 Kilometer) oder beschädigt (etwa 120 km).
Klimawandel lässt Meeresspiegel steigen – Schleswig-Holsteinern steht das Wasser zum Hals
Die damalige Landesregierung beschloss danach, den Küstenschutz landesweit in einem Generalplan zu regeln. Am Montag wurde auf Nordstrand nun die fünfte Fortschreibung des Generalplanes vorgestellt – auch unter dem Eindruck des Klimawandels. Angesichts des erwarteten Anstieges des Meeresspiegels und stärkerer Sturmfluten seien Küsten- und Hochwasserschutz in Schleswig-Holstein heute relevanter denn je, sagte Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne).
Als Land zwischen den Meeren mit einer Küstenlinie von 1100 Kilometern stehe Schleswig-Holstein in Zeiten des verschärften Klimawandels vor besonderen Herausforderungen, sagte der Minister. Mit dem neuen Generalplan für den Küstenschutz soll die Grundlage dafür geschaffen werden, dass die Menschen an den Küsten auch in den nächsten Jahrzehnten in Sicherheit leben könnten.
Das könnte Sie auch interessieren: Februar-Wärme-Rekord in Hamburg: Experte: „Klimawandel hat Deutschland erreicht“
Schwerpunkt des Plans ist seine nachhaltige Anpassung an den Klimawandel und dessen Folgen. Überarbeitet werden mussten die Pläne unter anderem, weil es neue Erkenntnisse zum künftigen Meeresspiegelanstieg gibt. Außerdem müssen das Warftverstärkungs- und Entwicklungsprogramm der Landesregierung und die regelmäßig stattfindenden Deichsicherheitsüberprüfungen eingearbeitet werden, teilte das Ministerium mit.
Landesschutzdeiche werden „Klimadeiche“
Deichverstärkungsmaßnahmen bleiben weiter von herausragender Bedeutung. 74 Kilometer Landesschutzdeiche sollen zu „Klimadeichen“ umgebaut werden. Diese sind nach derzeitigem Kenntnisstand bis in das nächste Jahrhundert sicher, auch wenn die ungünstigsten Prognosen zum künftigen Meeresspiegelanstieg eintreffen.

Die neuen Klimadeiche werden hierfür nicht nur höher, sondern haben anders als ihre Vorgänger ein flachereres Profil und eine verbreiterte Deichkrone. So können sie Sturmwellen länger standhalten. Zudem sind die Deiche mit einer Baureserve versehen: Sie können – falls nötig – künftig weiter ertüchtigt werden.
Für diesen Ausbau der Deiche werden aktuell 360 Millionen Euro veranschlagt, die aus Mitteln des Landes, des Bundes und der EU kommen. „Es handelt sich um eine existenzielle Investition in die Sicherheit unseres Landes und unserer Bürgerinnen und Bürger“, sagte Albrecht. Weitere Schwerpunkte des Generalplans sind – neben der Unterhaltung der Küstenschutzanlagen – die Sandersatzmaßnahmen vor Inseln und die Warftverstärkungen auf den Halligen.
Das könnte Sie auch interessieren: Nicht als Aktivistin: Gretas kleine Schwester startet als Sängerin durch
Bereits in den vergangenen zehn Jahren wurden etwa 25 Kilometer Landesschutzdeiche sowie drei Halligwarften verstärkt und 14,7 Millionen Kubikmeter Sand aufgespült. Insgesamt wurden unter anderem für diese und für Unterhaltungsmaßnahmen in dem Zeitraum rund 740 Millionen Euro ausgegeben.
Neuer Generalplan für künftige Generationen
„Mit dem neuen Generalplan Küstenschutz schaffen wir in Zeiten des Klimawandels eine langfristige Grundlage für Wohnen und Wirtschaften in den Küstenniederungen und an den Küsten Schleswig-Holsteins“, sagte Albrecht. „Damit übernehmen wir Verantwortung auch für künftige Generationen, die nicht für den menschengemachten Klimawandel verantwortlich sind.“
Etwa ein Viertel der Landesfläche Schleswig-Holsteins ist potenziell durch Sturmfluten gefährdet. Mehr als 330.000 Menschen leben in überflutungsgefährdeten Landesteilen. Betroffen sind zudem rund 60 Milliarden Euro an Sachwerten.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.
Ein strategischer Schwerpunkt des Küstenschutzes der kommenden Jahre liegt in der Erstellung der Gesamtstrategie „Entwicklung Ostseeküste 2100“. Bis Ende 2024 wollen Küstenschutz, Naturschutz und Tourismus gemeinsam eine Strategie für die Ostseeküste entwickeln, die nachhaltig und langfristig an die Folgen des Klimawandels angepasst ist. Dies soll durch nachhaltige Schutzmaßnahmen und klimaangepasste Nutzungen gelingen. „Gerade an der Ostseeküste sind nachhaltige Nutzungsformen von großer Bedeutung, da hier Sandersatzmaßnahmen wie vor Sylt nicht möglich sind“, sagte Albrecht.
Auch aus diesem Grund nimmt der Generalplan mögliche Synergien durch die Nutzung von Ökosystemleistungen verstärkt in den Blick. Als Beispiele werden Steilufer an der Ostseeküste und die Salzwiesen im Wattenmeer genannt. Der an Steilufern bei Sturmfluten freigesetzte Sand stabilisiert den Angaben zufolge die Strände, während vorgelagerte Salzwiesen die Wellenbelastungen auf den Deichen bei Sturmfluten reduzieren. Beide Leistungen erhalten ihre Wirkung auch bei einem beschleunigten Meeresspiegelanstieg. Steilufer sollen deshalb künftig von Sicherungsbauwerken freigehalten werden. (dpa/mp)

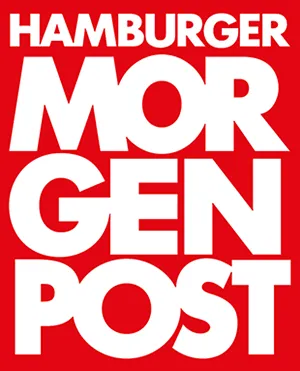

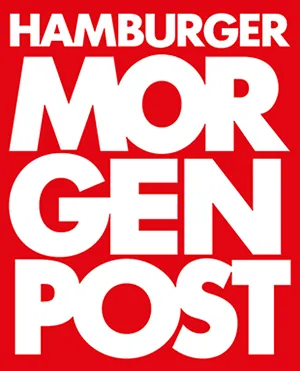
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.