Zwangsarbeit in Hamburg: Italiener wurden bespuckt, beschimpft und ausgebeutet
Hamburg am Ende des Zweiten Weltkrieges: praktisch ein einziges Zwangsarbeiterlager. Rund 500.000 Menschen, verschleppt aus ihren Heimatländern, schuften zwischen 1939 und 1945 unter erbärmlichsten Bedingungen in Industrie- und Gewerbebetrieben oder müssen Trümmer beseitigen. Viele verhungern, nehmen sich aus Verzweiflung das Leben oder sterben bei alliierten Luftangriffen – denn in die Luftschutzkeller dürfen sie nicht. Am schlechtesten werden sowjetische Gefangene behandelt – in den Augen der Nazis „Untermenschen“. Nur noch eine Gruppe gibt es, die in der Gefangenen-Hierarchie auf ähnlich niedriger Stufe steht: Italiener. Ausgerechnet Italiener.
Da ist zum Beispiel Luigi Cattaneo, ein Kfz-Mechaniker, geboren im August 1913 in Mailand. 1943 wird der italienische Soldat von der Wehrmacht festgenommen und nach Hamburg gebracht wie Tausende seiner Kameraden auch.
Er wird eingesperrt in einem Zwangsarbeiterlager, das sich im elften Stock des Heinrich-Bauer-Hauses, Schützenpforte 11, befindet. Cattaneo stirbt am 1. Januar 1945 im Alter von nicht mal 32 Jahren. Aus der Sterbeurkunde geht die Todesursache nicht hervor.
Zwangsarbeiter durften nicht in die Luftschutzbunker
Emilio Bova aus dem 400-Seelen-Dorf Montalto in Ligurien, Bauer von Beruf, wird nur 20 Jahre alt. Ein zierlicher Mann mit welligem Haar. Er ist ebenfalls im Lager Heinrich-Bauer-Haus untergebracht, muss jeden Tag zum Arbeitseinsatz, zwölf Stunden ohne Pause und ohne ausreichend Verpflegung.
In Hamburg ums Leben gekommen: der italienische Gefangene Luigi Cattaneo
ANRP Italia
Im Juni 1944 stürzt er, erleidet einen Schädelbruch und wird tags darauf auf dem Ohlsdorfer Friedhof verscharrt. Sein Wunsch, die Heimat, die Mutter, den Vater, die Geschwister wiederzusehen, geht nicht in Erfüllung.
Oder Davide Galli, ein Transportarbeiter, geboren am 3. Oktober 1910 in San Dalmazio bei Pisa. Er wird in Wilhelmsburg zur Zwangsarbeit eingesetzt – und stirbt gemeinsam mit etlichen anderen Italienern bei einem alliierten Bombenangriff am 31. Dezember 1944.
Italienische Soldaten wurden wie Verräter behandelt
Die Liste der italienischen Gefangenen, die im Arbeitseinsatz in Hamburg sterben, ist lang, sehr lang: Pietro Baselli wird nur 23 Jahre alt, Guiseppe Di Fini 26, Sante Frisan 25, Luigi Fuzi 21, Lucia Giordano 18, Antonio Libralesso 32, Salvatore Fatti 23, Giuseppe Rosighetti 34 Jahre. Wir könnten noch viele weitere Namen aufzählen. Alles junge Männer, die ihr Leben noch vor sich hatten.
In Hamburg ums Leben gekommen: der Gefangene Emilio Bova
ANRP Italia
Womöglich ist der Tod für sie aber sogar eine Erlösung, denn Hamburg stellt für italienische Gefangene so etwas wie die Hölle auf Erden dar. Auf Sympathie der Bevölkerung, auf Freundlichkeit ihrer Bewacher, auf ein Stück Brot, das ein Passant ihnen voller Mitleid zusteckt – nein, auf solche Zeichen von Menschlichkeit warten sie vergeblich. Stattdessen werden sie mit Steinen beworfen oder von Kindern bespuckt – sie, die „Badoglio-Verräter“.
Liste mit italienischen Zwangsarbeitern, die zu Tode kamen.
Initiative „Kein Vergessen im Kontorhausviertel“
Der Sturz von Diktator Mussolini brachte die Wende
Der 8. September 1943 ist der Wendepunkt im deutsch-italienischen Verhältnis. Bis dahin sind Rom und Berlin Verbündete. Doch nach dem Sturz von Diktator Benito Mussolini vereinbart der neue Regierungschef Pietro Badoglio einen Waffenstillstand mit den Alliierten und erklärt Deutschland anschließend sogar den Krieg.
Adolf Hitler und Benito Mussolini: Nachdem der italienische Diktator 1943 gestürzt ist, schließt Rom einen Waffenstillstand mit den Alliierten.
picture alliance / dpa
Was aber ist mit den italienischen Soldaten an der Front, die Seite an Seite mit den Deutschen kämpfen? Sie werden von der Wehrmacht vor die Wahl gestellt: auf deutscher Seite weiterzumachen oder in Gefangenschaft zu gehen.
Ohne Rücksicht auf internationales Recht: Italiener werden zu Zwangsarbeiter
Rund 600.000 Italiener sagen Nein, lassen sich daraufhin meist widerstandslos festnehmen: Rund 11.000 von ihnen werden ermordet, die übrigen zu sogenannten „Militärinternierten“ erklärt – ein Gefangenenstatus, den die Genfer Kriegsrechtskonvention gar nicht kennt.
Der italienische Gefangene Ludovico Lisi hat seine Erlebnisse als Zwangsarbeiter in Deutschland künstlerisch verarbeitet in solchen Aquarellen.
Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit
Ohne Rücksicht auf internationales Recht werden die Italiener anschließend als Zwangsarbeiter in der deutschen Rüstungsproduktion eingesetzt. Um die 12.500 Italiener unterzubringen, die ab September/Oktober 1943 in Viehwaggons meist auf dem Umweg über das Stalag X B Sandbostel, dem größten Kriegsgefangenenlager Nazi-Deutschlands, nach Hamburg transportiert werden, verwandeln die NS-Behörden in Windeseile zahlreiche öffentliche Gebäude in Zwangsarbeiterlager. Darunter vor allem Schulen – wie beispielsweise die Schule an der Schanzenstraße.
Schon ein Jahr zuvor war sie ein Ort des Grauens, als sich dort rund 1700 Hamburger Juden einfinden mussten, um nach Theresienstadt deportiert zu werden. Nun ist sie ein Gefängnis für 400 italienische Soldaten – und auch von ihnen sehen viele ihre Heimat nicht mehr wieder.
Die Fotos italienischer Gefangener sind eine besondere Rarität. Sie wurden im Kriegsgefangenenlager Stalag X B Sandbostel aufgenommen, und zwar vom italienischen Offizier Vittorio Vialli.
Vittorio Vialli, Istituto Storico Parri Emilia-Romagna, Bologna, Italien
Liste liest sich wie das „Who’s Who“ der Hamburger Wirtschaft
Nahezu jedes im Krieg noch nicht zerstörte und nicht genutzte Gebäude in der Stadt mieten die NS-Behörden im Herbst 1943 an, um Platz für Italiener zu schaffen: auch das Kontorhaus des Heinrich-Bauer-Zeitschriftenverlags gehört dazu.
Hier waren ab Herbst 1943 rund 400 italienische Gefangene eingesperrt: alte Volksschule Schanzenstraße.
Olaf Wunder
Für Verleger Alfred Bauer ist die Mietzahlung der Stadt eine willkommene Einnahmequelle – denn aufgrund von Papiermangel steht sein Betrieb damals ohnehin still. Im elften Stock werden 700 italienische Militärinternierte (IMIs) unter erbärmlichen Bedingungen einkaserniert und von dort jeden Morgen mit vorgehaltener Waffe zu ihren Arbeitseinsätzen getrieben.
Bekannte Namen auf der Liste der Firmen, die Zwangsarbeiter einsetzten
Holger Artus, ehemaliger MOPO-Betriebsratschef und Mitbegründer der Initiative „Kein Vergessen im Kontorhausviertel“, hat im Staatsarchiv die Firmen recherchiert, die zwischen 1943 und 1945 Italiener zur Zwangsarbeit einsetzten.
Fürchterliche Lebensumstände herrschten für die Gefangenen im Kriegsgefangenenlager Stalag X B Sandbostel
Gedenkstätte Sandbostel
Ergebnis: Die Liste liest sich wie das „Who’s Who“ der Hamburger Wirtschaft: Beiersdorf, Dyckerhoff & Widmann, Philipp Holzmann, HEW, Hamburger Hochbahn, Hamburger Wasserwerke, Rudolf Otto Meyer, H. O. Persiehl, August Prien, Raab Karcher, Strom- und Hafenbau (heute Hamburg Port Authority), Blohm + Voss und die Stadtreinigung. In insgesamt 500 Firmen sind die Italiener damals tätig. Das bekannte Bekleidungshaus C&A gehört übrigens auch dazu.
50.000 Italiener überleben die Gefangenschaft nicht
Mit dem Einmarsch der Briten am 3. Mai 1945 ist der Krieg für Hamburg zu Ende – und die vielen Tausend Zwangsarbeiter, die so viele Qualen erdulden mussten, sind endlich frei. Vom „Lager Zoo“ im heutigen Park Planten un Blomen, wo die Briten sogenannte „Displaced Persons“ in Baracken unterbringen, beginnt am 25. August 1945 die Rückführung.
Gedenkstätte des Stalag X B Sandbostel: Auf solchen mehrstöckigen Betten verbrachten die Gefangenen die Nacht.
Holger Artus/hfr
31.000 italienische Militärinternierte aus Hamburg und Schleswig-Holstein treten die Heimreise an. Bis zum 15. August setzen sich am Hauptbahnhof Nacht für Nacht Züge Richtung Brenner in Bewegung, besetzt mit jeweils 2000 Italienern.
Das alte Heinrich-Bauer-Verlagshaus: 1943 entstand im Gebäude ein Lager für 700 italienische Militärinternierte.
Bauer Media Group
Rund 50.000 „IMIs“ überleben den Aufenthalt in Deutschland nicht. Eine Entschädigung, wie sie Berlin in den Jahren 2000 bis 2007 aufgrund internationalen Drucks an überwiegend osteuropäische Zwangsarbeiter bezahlt, bekommt von ihnen keiner.
„Rein arisch“ zu sein (links neben dem Logo) – damit warb die Firma C&A in der NS-Zeit.
MOPO-Archiv
Das oberste italienische Gericht kommt zwar zu dem Schluss, dass das, was den italienischen Soldaten angetan worden ist, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit war und ihnen deshalb eine Entschädigung zusteht, aber die Bundesrepublik weigert sich zu zahlen. Nach deutscher Rechtsauffassung sind die „IMIs“ keine Kriegsgefangenen gewesen – und deshalb gibt’s auch kein Geld.
Profitierte von Zwangsarbeit: Modefirma C&A
Tausende von Unternehmen haben vom NS-Staat, von Krieg und Holocaust profitiert. Zwei von ihnen: C&A Brenninkmeyer und der Heinrich-Bauer-Verlag.
Die Firma C&A, eigentlich ein niederländisches Unternehmen, hat sich schon vor 1933 an die Nazis angebiedert und in ihren Filialen bewusst keine Juden beschäftigt. Nach der Machtübernahme Hitlers betont das Unternehmen, wie arisch es doch sei. C&A macht bei der Arisierung jüdischen Besitzes gnadenlos mit.
Drei italienische Militärinternierte arbeiteten bei C&A in der Mönckebergstraße zwangsweise als Schneider.
Initiative „Kein Vergessen im Kontorhausviertel“
Als beispielsweise in Bremen die jüdische Besitzerin eines Textilhandelshauses gezwungen wird, weit unter Wert zu verkaufen, nutzt C&A die Gelegenheit und schlägt zu: Die Immobilie samt Geschäft wird übernommen.
C&A schreckt auch nicht davor zurück, Tausende Insassen des Ghettos Litzmannstadt (Lodz) als Schneider zu beschäftigen und sie Uniformen für die Wehrmacht produzieren zu lassen.
Foto von einer Kundgebung im September: Vor dem Gebäude der Bauer Media Group wird der italienischen Militärinternierten gedacht.
Olaf Wunder
Um die ganze Wahrheit zu erfahren, beauftragte C&A 2015 den Historiker Mark Spoerer damit, die Firmengeschichte zu erforschen. Inzwischen gibt es ein Buch, das rückhaltlos darstellt, wie sehr das Modeunternehmen gemeinsame Sache mit den Nazis machte.
Bauer will Firmengeschichte aufarbeiten lassen
So weit ist der Heinrich-Bauer-Verlag, heute Bauer Media Group, noch nicht. Lange hat das Unternehmen, das im „Dritten Reich“ mit der „Funk-Wacht“ eine der größten Rundfunkzeitschriften herausgab, vehement bestritten, irgendwas mit der NS-Diktatur zu tun gehabt zu haben. In der schriftlichen Firmenhistorie klafft bis heute zwischen 1927 und 1945 ein riesiges Loch – so, als hätte es diese Zeit nicht gegeben.
Erst als 2020 im Staatsarchiv Dokumente auftauchten, die belegen, dass das Unternehmensgebäude in ein Lager für 700 italienische Militärinternierte umgewandelt worden war (gegen Miete, versteht sich) und außerdem Verleger Alfred Bauer von der Arisierung jüdischer Immobilien profitierte, hat ein Umdenken eingesetzt.
Die Bauer Media Group will nun auch einen Historiker beauftragen, die Firmengeschichte aufzuarbeiten. Derzeit werde Quellenmaterial gesichtet und katalogisiert, so Firmensprecherin Imke Weiland zur MOPO. Im zweiten Schritt werde eine „Analyse und Evaluation der Quellen mitsamt Einbettung in den historischen Kontext“ erfolgen.
Weitere Infos zum Thema
Fall Sie mehr wissen wollen zu diesem Thema, empfehlen wir Ihnen den Besuch der Gedenkstätte Stalag X B in Sandbostel in der Nähe von Bremervörde. Dort befand sich das größte Kriegsgefangenenlager Nazi-Deutschlands. Nähere Infos: https://www.stiftung-lager-sandbostel.de. Ebenfalls empfehlenswert: das Dokumentationszentrum Zwangsarbeit in Berlin https://www.ns-zwangsarbeit.de/home/, das eine Ausstellung über italienische Militärinternierte aufgebaut hat.

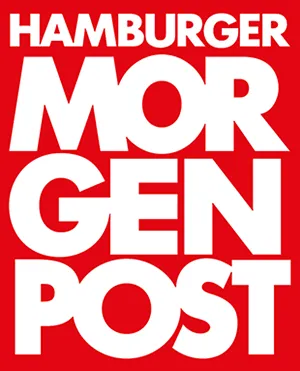

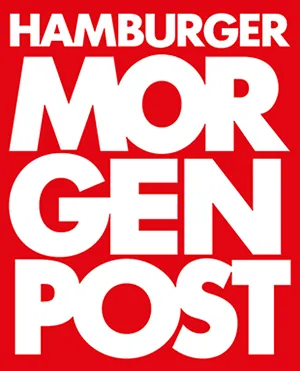
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.