 Tennis mit Sehschwäche: Hier rasseln die Bälle beim Spiel
Tennis mit Sehschwäche: Hier rasseln die Bälle beim Spiel
„Ready?“, „Yes!“, „Play!”, klingt es immer wieder durch die Tennishalle vom Betriebssport-Verband Hamburg, bevor ein gelber, rasselnder Ball zwischen zwei Spielern hin und her springt. Die Spieler jagen dem seltsam großen Tennisball hinterher – lassen ihn zwischendrin aber nicht nur einmal, sondern teils dreimal aufkommen. Sascha und Miro, Vizemeister und Deutscher Meister, erklären ihre Art von Tennis, die viel schwieriger ist, als sie zuerst scheint.
DE-DE
- Deutsch (Deutschland)
MOPO+ Abo
für 1,00 €Jetzt sichern!Neukunden lesen die ersten 4 Wochen für nur 1 €!Zugriff auf alle M+-ArtikelWeniger Werbung
Danach nur 7,90 € alle 4 Wochen //
online kündbarMOPO+ Black Week Deal
1 Jahr für 52 €Jetzt sichern!1 Jahr M+ für 1 € pro Woche lesen!Zugriff auf alle M+-ArtikelWeniger Werbung
Im zweiten Jahr 79 € //
online kündbar

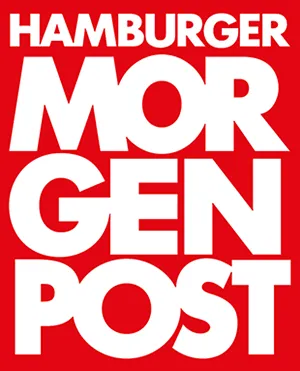

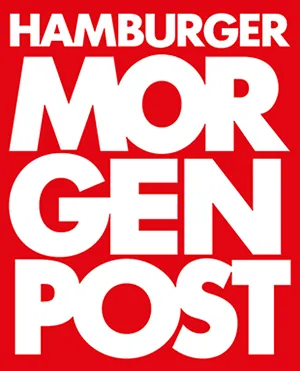
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.