 Hungerstreik und Werksbesetzung: Der Kampf gegen das Werftensterben in Hamburg
Hungerstreik und Werksbesetzung: Der Kampf gegen das Werftensterben in Hamburg
Wenn Holger Mahler heute die Fotos anschaut von dem Arbeitskampf damals, dann ist da wieder dieses Feuer in seinen Augen. 40 Jahre jünger wirkt er plötzlich. Zwar haben die Arbeiter, die 1983 neun Tage lang die Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (HDW) besetzt hielten, ihr Ziel verfehlt. Sie konnten die Massenentlassungen auf Hamburgs größter Werft nicht verhindern. „Trotzdem waren wir die Sieger“, findet er. „Weil wir uns nicht einfach unserem Schicksal ergeben haben. Wir haben gekämpft und uns so unsere Würde bewahrt.“
DE-DE
- Deutsch (Deutschland)
MOPO+ Abo
für 1,00 €Jetzt sichern!Neukunden lesen die ersten 4 Wochen für nur 1 €!Zugriff auf alle M+-ArtikelWeniger Werbung
Danach nur 7,90 € alle 4 Wochen //
online kündbarMOPO+ Black Week Deal
1 Jahr für 52 €Jetzt sichern!1 Jahr M+ für 1 € pro Woche lesen!Zugriff auf alle M+-ArtikelWeniger Werbung
Im zweiten Jahr 79 € //
online kündbar

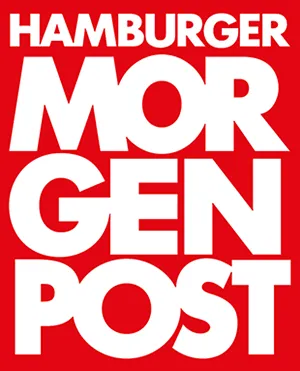

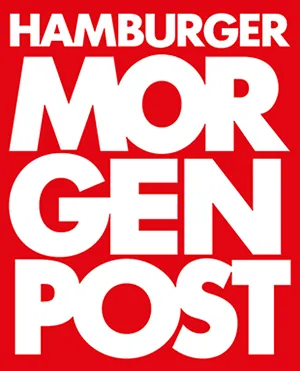
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.