 Lohsepark: (Letzte) Lebenszeichen deportierter Hamburger Juden
Lohsepark: (Letzte) Lebenszeichen deportierter Hamburger Juden
„Denke an unsere gegenseitigen Versprechen beim Abschied. Guckst Du jeden Abend zu den Sternen hinauf und denkst an mich? Das habe ich bis jetzt jeden Abend getan gegen neun Uhr. Ich bin in Gedanken immer bei Dir und das bleibt.“ Das schrieb Henriette Arndt am 5. Dezember 1941 aus dem Ghetto Litzmannstadt (Lodz) an ihre Freundin Lotti in Hamburg. Es ist eine ihrer letzten Postkarten, bevor die SS sie im Mai 1942 im Vernichtungslager Kulmhof ermordete. Die Freundinnen haben sich nie wiedergesehen.
DE-DE
- Deutsch (Deutschland)
MOPO+ Abo
für 1,00 €Jetzt sichern!Neukunden lesen die ersten 4 Wochen für nur 1 €!Zugriff auf alle M+-ArtikelWeniger Werbung
Danach nur 7,90 € alle 4 Wochen //
online kündbarMOPO+ Black Week Deal
1 Jahr für 52 €Jetzt sichern!1 Jahr M+ für 1 € pro Woche lesen!Zugriff auf alle M+-ArtikelWeniger Werbung
Im zweiten Jahr 79 € //
online kündbar

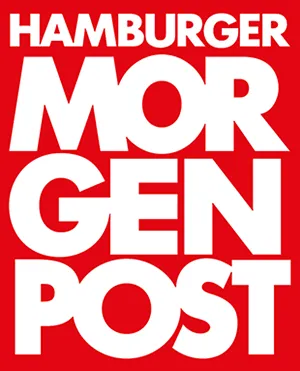

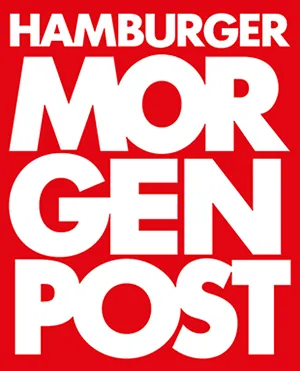
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.