Heiße Eisen sind sein Ding: Dieser Hamburger ist einer der letzten Schmiede
Waffen-, Kessel- oder auch Hufschmiede gab es früher viele. Heute ist der Beruf rar geworden. Meister Johannes Rienhoff aus Hamburg darf als einer der letzten seiner Art gelten.
Eigentlich gibt es gar keine Schmiede mehr. Denn seit der Novellierung der Handwerksberufe von 1989 spricht man offiziell von Metallbauern – in den Fachrichtungen Konstruktionstechnik, Nutzfahrzeugbau und Metallgestaltung. Dabei existiert die Fähigkeit, Metalle extrem stark zu erhitzen und dann mit Hammer und Amboss zu formen, seit Urzeiten. Und sie hat die Menschheit zu Mythen und Märchen angeregt.
In der griechischen Antike etwa wurde Hephaistos als Schmied der Götter und als Kulturbringer verehrt. Bei den Germanen richteten die Götter bereits vor Erschaffung der Menschen Schmieden ein, um Werkzeuge herzustellen. Noch im 19. Jahrhundert hatten Huf- und Wagenschmiede als unheimlich kräftige Männer in dunklen, nur von Feuer erleuchteten Arbeitsstätten in ihren Dörfern eine Sonderstellung.
Meister und Restaurator im Handwerk
Auch Johannes Rienhoff, der eine insgesamt zehnjährige Ausbildung durchlaufen hat, sieht sich als Schmied. „Auf meiner Visitenkarte steht ‚Schmiedemeister und Restaurator im Handwerk‘“, sagt der 39-Jährige so selbst- wie traditionsbewusst der dpa. Laut Auskunft der Metall-Innung Hamburg führt er als Gestalter den einzigen Innung-gebundenen Betrieb seiner Art in der Stadt.
Rienhoff, ein beeindruckend markanter und muskulöser gebürtiger Schleswig-Holsteiner mit Brandnarben an den Armen, übernahm 2012 die renommierte Kunstschmiede Lehmann, die seit 2019 im Stadtteil Altona ansässig ist. In einer Halle von 500 Quadratmetern stellt er mit einem weiteren Meister, einem Gesellen und fünf Lehrlingen Tore und Zäune, Überdachungen und Geländer, Möbel und Firmenschilder her – oft nach eigenen Entwürfen. Oder er repariert, rekonstruiert und restauriert wertvolles Altes.

Schon vor dem Eingangstor dröhnt gleichmäßig lautstarkes Hämmern. „Das geht von morgens bis abends so“, sagt Rienhoff lachend und führt durch seine Räume. Das Herz ist die Esse, eine Art großer Koks-Herd, dessen Rauch ein elf Meter langes Rohr nach außen abführt. Drei Feuer – somit drei Arbeitsplätze – gibt es hier. Und während sich die Glut bis zu 1800 Grad aufheizen lässt, haben es die, die davorstehen und mit langen Zangen Stahl und Eisen oder auch Kupfer und Messing zum Glühen bringen, immerhin zwischen 40 bis zu 60 Grad warm. Derzeit lagern dort in Kisten Tausende von stumpf gewordenen Presslufthammer-Meißeln, die durch Schlagen auf dem Amboss neu gespitzt werden sollen – einer der Serien-Wartungsaufträge von Abbruchunternehmen.
Filigrane Rosenblätter
Ein paar Schritte weiter hantiert Naima Waage, Lehrling im vierten Jahr, mit einem Schweißbrenner. Sorgsam formt die 28-Jährige aus Eisen, das sie zuvor in der Esse erhitzt hat, filigrane Rosenblätter – Teile eines 24 Meter langen Zauns mit Blumenornamenten und stilisierten Tieren. Frauen sind in diesem Handwerk eher selten, doch Rienhoff sieht kein Problem. „Wenn eine Aufgabe mal mehr Körperkräfte verlangt, springt ein Kollege ein. Ohnehin arbeiten wir oft zu zweit an einem Stück“, erklärt der Chef. Gerade fertiggestellt ist ein Objekt für die St. Michaelis-Kirche – den berühmten Michel. Für den Eingangsbereich schuf die Schmiede eine Vitrine, die nun eine besondere Bibel sicher birgt.

Zur Ausstattung der Werkstatt gehören auch zwei Gasöfen, drei Lufthämmer, eine Fülle an Schraubstöcken, Richtplatten, Lochplatten und Biegemaschinen sowie Regale mit hunderten Hämmern und Zangen. Auf einem großen Regal lagern sechs Meter lange Stahlprofile. „Das ist unser Grundmaterial – Profilstahl, der meist aus Polen, Ukraine, Italien, Indien oder auch China stammt“, sagt Rienhoff. In Deutschland, einst ein großer Stahlstandort, werde fast nur noch hochwertiger Sonder-, Werkzeug- und Panzerstahl hergestellt.
Mit 12 Jahren dem Hufschmied geholfen
Wie er zu alledem gekommen ist, erzählt der 39-Jährige bei einem Kaffee im Büro auf der Empore. Als Sohn eines Ingenieurs, dessen Familie auch Landwirtschaft und Pferdezucht betrieb, begann er schon mit zwölf, dem Hufschmied bei seiner Arbeit zu helfen. Mit 15 verließ Rienhoff jedoch den Hof, um auf ein Sportinternat zu gehen und Leistungssportler zu werden. Als Stabhochspringer war er jahrelang in der Jugend-Nationalmannschaft der Leichtathleten – bis zu viele Verletzungen seiner Karriere ein Ende setzten. Damals, nach seinem Wehrdienst, fiel ihm seine frühe Begeisterung fürs Schmieden wieder ein.
Der junge Mann absolvierte eine Lehre in der Nähe von Flensburg, erhielt als Landessieger Begabtenförderung – und entdeckte die Vielseitigkeit des Berufs. Gleich im Anschluss besuchte er sechs Monate lang das Vollzeitmodul der Landesfachschule Metall in Lüneburg, die er als Meister mit der Note eins beendete. Bald darauf ergab sich die Möglichkeit, beim alten Inhaber der Schmiede Lehmann zu arbeiten und diese zu übernehmen. Von 2019 bis 2022 besuchte Rienhoff zusätzlich die Akademie des Handwerks auf Schloss Raesfeld (NRW) – für seine Qualifikation als Restaurator.
Das Handwerk am Leben erhalten
Letzteres bewirkt, dass der Kunstschmied oft an seinem Schreibtisch sitzt, um für seine Auftraggeber nach gründlichen Recherchen vor Ort Entwürfe und Planungen zu entwickeln – auch in Abstimmung mit der Denkmalbehörde. Wie vielleicht die Reparatur eines alten Zauns für eine Jugendstilvilla und dazu die stilgerechte neue Überdachung einer Terrasse. Rienhoff zeichnet alles mit Bleistift, Computerprogramme nutzt er selten. Dabei liebt er gerade auch die praktische Arbeit. „Wenn ich könnte, würde ich jede Minute unten in der Werkstatt sein“, sagt er. „Ich mag gerne alles, wobei ich richtig reinlangen kann– und abends dann körperlich ausgepowert auf die Matratze sinke.“
Wie nebenbei erzählt er noch, dass er seit Jahren auch jungen Leuten eine Chance biete, „die Schwierigkeiten haben“. In Zusammenarbeit mit Einrichtungen bildet er Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen, Missbrauchsopfer, straffällig Gewordene aus oder begleitet sie in der Wiedereingliederung. „Wenn ich einen von ihnen unten ans Feuer stelle, wird er ein anderer Mensch. Weil es so elementar ist, dass es dich ganz direkt packt. Man muss sich konzentrieren und einen Plan haben.“
Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgerin mit besonderem Job: Sie sorgt dafür, dass Sie nicht nass werden
Tatsächlich habe er schon manchen in die Spur bringen können. „Das ist mein Dienst“, sagt Rienhoff. Er fügt hinzu, dass er seinen Mitarbeitern all sein Know-how weitergebe und nichts als vermeintliches Betriebsgeheimnis verheimliche. Auf diese Weise möchte er auch sein selten gewordenes Handwerk am Leben erhalten.

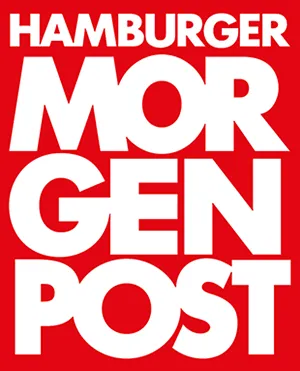

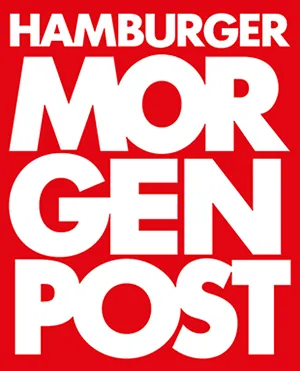
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.