Schuld und Düne – und eine fast vergessene Sprache
Auch Tage nach dem Kinobesuch weiß ich noch nicht, was ich von Fatih Akins „Amrum“ halten soll, der in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs spielt. Einerseits eben Regisseur Akin und große Bilder der Nordsee und Deutschlands beste Schauspieler. Andererseits eine gefühlte emotionale Leere durch eine friesische Naziwelt in „Schöner wohnen“-Ästhetik, in der das Hemd des Hitler-Pimpfs trotz depressiver Mutter und Führers Abtritt akkurat gebügelt bleibt.
Ein Film wie eine Fleißarbeit voller Klischees, vom brummigen Fischer bis zum Walknochen vor einem Kapitänshaus, das in Wirklichkeit nicht auf Amrum, sondern irgendwo in Dänemark steht. Schmutz und Armut und Entbehrungen sind nicht vorgesehen, nur die Butter wird knapp. Der Krieg liegt einmal kurz am Strand, in Person eines abgestürzten Piloten, dem Möwen die Augen rausgepickt haben.
Ein Propagandist der arischen Rassenlehre ist im Film ein abwesender, aber mitfühlender Familienvater und das wichtigste Problem zu Zeiten des Volkssturms ein fehlendes Honigbrot. Mag sein, dass Nazi-Verkitschung in manchen Gegenden Deutschlands derzeit en vogue ist. Warum sich ausgerechnet Fatih Akin daran beteiligt, ist eine andere Frage.

Der Autor: Stefan Kruecken, Jahrgang 1975, leitet mit seiner Frau Julia den von ihnen gegründeten Ankerherz Verlag (www.ankerherz.de). Vorher war er Polizeireporter für die „Chicago Tribune“, arbeitete als Reporter für Zeitschriften wie „Max“, „Stern“ und „GQ“ von Uganda bis Grönland. Sein neues Buch „Das muss das Boot abkönnen“ gibt es im MOPO-Shop unter mopo.de/shop. Weitere Bücher gibt es im Ankerherz-Shop – zum Beispiel „Das kleine Buch vom Meer – Helden“ oder „Mayday – Seenotretter über ihre dramatischsten Einsätze“.
Alle aktuellen Folgen dieser Kolumne finden Sie hier.
Eine Leistung aber bietet „Amrum“. Die Insulaner reden konsequent „Öömrang“, eine fast vergessene Sprache, die auf der Insel nur noch knapp 600 Menschen beherrschen. Wie schön ist diese, ja: eigene Sprache!
Während man sich in Dialekte „hineinhören“ kann und im Kölsch oder Hessisch oder sogar Sächsisch noch irgendetwas wiedererkennt, wird aus Mädchen „Foomen“, aus Junge „Dring“, aus Feuer „ial“ und aus einer Kirche „en sark“. Ohne Untertitel bliebe nur: Moin. Öömrang klingt irgendwie Niederländisch mit englischen Zutaten durch einen isländischen Mixer gedreht.
Das könnte Sie auch interessieren: Donald Trump ist „Captain Evil Orange“
Moderne Worte – so klaube ich es mir im Internet zusammen – gibt es in Öömrang anscheinend nicht. Modern meint in diesem Fall „Auto“ oder „Fernseher“, also „romelwaanj“ und „widjluker“, was sich beides im Alltagsgebrauch nicht durchsetze. Für „moderne Worte“ werden daher deutsche „Fremdwörter“ verwendet, so wunderbar archaisch ist Öömrang.
Wie schade wäre es, wenn diese Sprache verschwindet – oder, um es auf Öömrang zu sagen: „Jääw wi’t ap, det wiar en skun“ („Gäben wir es auf, das wäre eine Schande.“) In Fatih Akins „Amrum“ kommen die Deutschen auf die Insel und kapieren kein Wort. Für mich die schönste Pointe eines Films, den ich nicht verstehe.

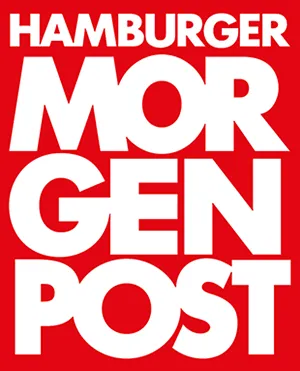

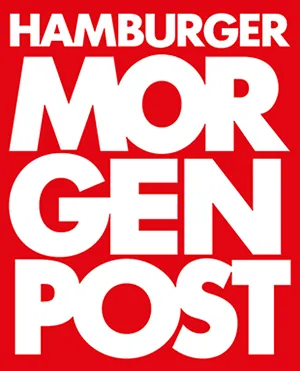
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.