 Mega-Wärmepumpe soll Hamburg mit Elbwasser heizen
Mega-Wärmepumpe soll Hamburg mit Elbwasser heizen
Ein Bad in der Elbe ist vielen selbst jetzt im Sommer zu kühl. Im Herbst und Winter ist das Wasser richtig eisig. Trotzdem soll der Fluss in Zukunft in der kalten Jahreszeit für warme Wohnzimmer und Küchen bei Tausenden Hamburgern sorgen. Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) spricht euphorisch von einem „Quantensprung“. Doch wie kann ziemlich kaltes Wasser das Verfeuern von Kohle ersetzen?
DE-DE
- Deutsch (Deutschland)
MOPO+ Abo
für 1,00 €Jetzt sichern!Neukunden lesen die ersten 4 Wochen für nur 1 €!Zugriff auf alle M+-ArtikelWeniger Werbung
Danach nur 7,90 € alle 4 Wochen //
online kündbarMOPO+ Black Week Deal
1 Jahr für 52 €Jetzt sichern!1 Jahr M+ für 1 € pro Woche lesen!Zugriff auf alle M+-ArtikelWeniger Werbung
Im zweiten Jahr 79 € //
online kündbar

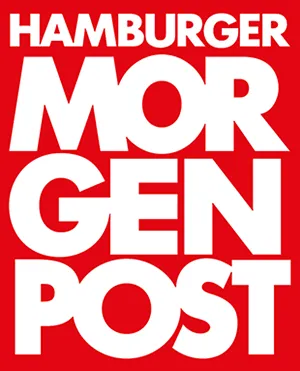

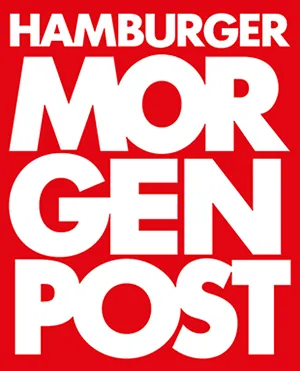
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.