Das Geheimnis der versunkenen Kanonen von Helgoland
Alles beginnt mit einer Bemerkung von Wilfried, einem alten Taucher. Er erzählt dem Unterwasserarchäologen Florian Huber bei einem Schnack im Inselhafen von Kanonen auf dem Meeresgrund. „Da um die Ecke“, in einem Abschnitt zwischen dem Felsen und der Düne von Helgoland.
Huber ist Forschungstaucher, ein blonder Bayer, Jahrgang 1975, den manche den „Indiana Jones“ der Unterwasserforschung nennen. Ihn lässt das Thema in den nächsten Jahren nicht mehr los – und er untersucht den Abschnitt, auf den Wilfried hinwies, systematisch mit seiner Firma Submaris.

Tauchen in der Nordsee ist gefährlich. Nur wenige Meter Sicht, starke Strömungen, aber für Forscher eine Art Miniaturwunderland. Viele Wracks, viel Geschichte von Säbelzahntigern im Doggerland, von Wikingern, Störtebeker und der Hanse bis Hitlers „Projekt Hummerschere“. Huber nennt das Revier: „megageil“.
Helgoland war bis 1890 britisch und ein wichtiger Stützpunkt der Marine
Die Forscher stoßen auf Kanonen, zwei bis drei Meter lang, stark von Algen bewachsen, von Krebsen bewohnt, 16 sind es insgesamt. Darauf zu erkennen: Der Markierungspfeil der Royal Navy („Broad Arrow“), das Herstellerzeichen „Samuel Walker & Co“ und das Monogramm des Königs: Georg III. Wie kommen sie auf den Meeresgrund? „An der Stelle, wo wir sie fanden, kann kein Schiff festgesteckt haben“, sagt Huber. Auch waren die Geschütze zu weit verstreut und es gibt keine Wrackreste. Der Archäologe hat nach Recherchen in britischen Archiven eine andere Theorie.

1807 lief das Kriegsschiff „HMS Explosion“ nach einem üblen Fehler des Lotsen auf eine Untiefe. Helgoland war bis 1890 britisch und ein wichtiger Stützpunkt der Marine. Der Lotse kam in ein berüchtigtes Londoner Gefängnis und das Schiff wurde vor die Düne gezogen und abgewrackt. Aus dem Holz baute man eine Lagerhalle und der Fockmast wurde zum Flaggenmast. Die Kanonen brachte man aufs Oberland, um die Insel vor feindlichen Schiffen und Piraten zu schützen.

Der Autor: Stefan Kruecken, Jahrgang 1975, leitet mit seiner Frau Julia den von ihnen gegründeten Ankerherz Verlag (www.ankerherz.de). Vorher war er Polizeireporter für die „Chicago Tribune“, arbeitete als Reporter für Zeitschriften wie „Max“, „Stern“ und „GQ“ von Uganda bis Grönland. Sein neues Buch „Das muss das Boot abkönnen“ gibt es im MOPO-Shop unter mopo.de/shop. Weitere Bücher gibt es im Ankerherz-Shop – zum Beispiel „Das kleine Buch vom Meer – Helden“ oder „Mayday – Seenotretter über ihre dramatischsten Einsätze“.
Alle aktuellen Folgen dieser Kolumne finden Sie hier.
„Ich vermute, die Kanonen wurden später absichtlich versenkt“, sagt Huber. Als das Deutsche Reich Helgoland im Tausch gegen Sansibar bekam, wollte man sie dem Kaiser nicht überlassen. Der Transport der alten Waffen zurück nach England lohnte sich nicht – also blieb die Entsorgung im Salzwasser. Ein Beweis für die Theorie gibt es bislang nicht. Noch nicht.
Das könnte Sie auch interessieren: 49 blinde Passagiere an Bord: Nervenkrimi auf hoher See
Vermutlich bleiben die bis zu zwei Tonnen schweren Kanonen auf dem Meeresboden. Zu teuer ist die Bergung, zu aufwändig die Konservierung. Huber wünscht sich aber, dass jene sieben Kanonen, die noch auf der Insel stehen, restauriert werden und frische Infotafeln bekommen. „Das hat doch Mehrwert für die Besucher“, findet er. Als Zeugen für die britische Historie von Deutschlands einziger Hochseeinsel.

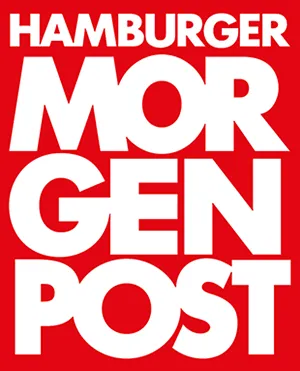

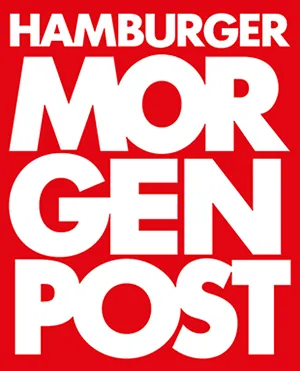
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.