„Jetzt haben wir hier Krieg“: MOPO-Reporter erlebte den Terror von Paris ganz nah
Es gibt Tage, die vergisst niemand. Der 13. November 2015 ist für mich ein solcher Tag. Für die MOPO hatte ich über das Testspiel zwischen Frankreich und dem amtierenden Weltmeister Deutschland berichten sollen. Auf ein Fußballfest hatte ich gehofft, plötzlich aber musste ich über einen der schlimmsten Terroranschläge der Nachkriegsgeschichte berichten. In der Nacht der Anschläge hatte ich entschieden, nicht abzureisen, sondern weiter zu berichten aus der Stadt, in der das Leben plötzlich stillstand.
Auf MOPO.de veröffentlichen wir zehn Jahre danach noch einmal die Texte von damals: der erste geschrieben im Stade de France mitten in der Nacht des Terrors, der zweite vom Tag danach, als ich unter anderem Augenzeugen vor dem Konzerthaus „Bataclan“ traf, und der dritte Text, als ich zwei Tage nach den Anschlägen zurückfuhr zum Stade de France, wo die Überreste eines Attentäters noch immer auf dem Bürgersteig klebten und wo deutlich wurde, dass ohne die Heldentat eines Mannes eine noch viel schlimmere Katastrophe gedroht hätte.
Text eins: „Die schrecklichste Nacht meines Lebens“
130 Tote, Anschläge an mindestens sieben verschiedenen Orten. Paris steht unter Schock. Die Welt steht unter Schock. Als MOPO-Reporter berichte ich aus der Metropole, in der zwölf Millionen Menschen leben.
In den Stunden, in denen ich diese Zeilen schreibe – es ist jetzt 2.05 Uhr – sitze ich noch immer im Presseraum des Stade de France, dem Tempel des französischen Fußballs, dem Austragungsort des Testspiels zwischen Frankreich und Deutschland.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!
Diese Woche u.a. mit diesen Themen:
- Krisen, Kriege, Koalitions-Ärger: Was würde Helmut Schmidt tun?
- Zu viele Elfenbeintürme: Wie Hamburg sich bei Mega-Projekten verzettelt
- Weihnachtsmärkte: Von frivol über sportlich bis traditionell – der große Überblick
- Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag
- 20 Seiten Sport: HSV-Profi Elfadli über Träume und einen besonderen Trikottausch & wie oft darf Alexander Blessin noch verlieren?
- 28 Seiten Plan7: Ausstellung zeigt Härte der Pflegeberufe, Bluesrock-Legende Walter Trout im Interview & Kultur-Tipps für jeden Tag
Ich hatte berichten sollen von einem Länderspiel, nun schreibe ich über Terror, über eine Stadt in Angst. Und, ja, ich kann es nicht leugnen, auch ich verspüre ein Gefühl der Unsicherheit, wie ich es noch nie erlebt habe.
„17.: Bombe?“, hatte ich auf meinen Notizzettel geschrieben
Die Bomben, die vor dem Stadion detonierten. Ein Geräusch, das ich nicht vergessen werde. Wahnsinnig laut waren die Explosionen. Mein Sitz vibrierte. Erst in der 17. Minute des Spiels, dann, zweimal kurz hintereinander, in der 20. Minute. „17.: Bombe?“, hatte ich auf meinen Notizzettel geschrieben. Ein ungutes Gefühl war sofort da. Die Gedanken kreisten zurück an die Bombendrohung, die am Vormittag im DFB-Team-Hotel eingegangen war. Nie aber hätte ich für möglich gehalten, was tatsächlich zeitgleich passierte.
Eine halbe Stunde später sickerten erste Informationen bis ins Stade de France durch. Von Schießereien. Von Bomben. Von einer Geiselnahme. Die Journalisten erfuhren früher davon als viele Zuschauer. Auf den Rängen gab es einen gespenstischen Mix aus Betroffenheit, Angst und Jubel über den französischen 2:0-Sieg. Letzterer wich aber sofort nach dem Abpfiff. Per Lautsprecher wurden die Zuschauer darauf aufmerksam gemacht, dass sie das Stadion nicht wie gewohnt verlassen können. 80.000 Menschen im Stade de France. Die Gefahr einer Panik. Doch das Krisen-Management der Franzosen war zumindest im Fußballstadion großartig. Nur vereinzelt kam es zu hektischen Szenen. Die Menschen sammelten sich auf dem Platz, nach und nach wurden sie über die Westtribüne hinausgeleitet. Sie blieben ruhig, aus ihren Gesichtern sprach Angst, Fassungslosigkeit, einige hatten Tränen in den Augen.

Auf der Pressetribüne bot sich ein ähnliches Bild. Tiefe Betroffenheit. Auch bei Bixente Lizarazu. Der Ex-Bayern-Profi ist Experte für das französische Fernsehen. Nun starrte er ins Leere. „Manchmal ist Fußball so unwichtig“, sagte er mir.
Von außerhalb drangen immer wieder Sirenengeräusche ins Stadion. Ein Hubschrauber kreiste über uns. Per Hubschrauber war zur Halbzeit auch Staatspräsident François Hollande, der neben Deutschlands Außenminister Frank-Walter Steinmeier gesessen hatte, ausgeflogen worden.
An jeder Ecke des Stadions standen Soldaten
Gegen 0 Uhr hatten auch die meisten Fans das Stadion verlassen. Die Bilder, die sich ihnen außerhalb des Stade de France boten? Verstörend! An jeder Ecke des Stadions und der Straßen Militär. Schwer bewaffnet. Maschinengewehre. Bilder wie aus einem Kriegsgebiet. Der Terror von Paris.
Freitag, der 13. – für mich hatte dieser Tag nie eine Bedeutung. Seit Donnerstagmorgen war ich in Paris. Am Louvre habe ich Freitagvormittag Fotos geschossen. Wenige Stunden später sollen auch dort Schüsse gefallen sein. Es schüttelt mich.
Paris. Weltoffen. Menschen aus fast allen Nationen der Erde leben hier. In der Metro stehen sie eng an eng gedrängt. Hautfarbe und Herkunft sind kein Thema. Ich mag diese Stadt.
Der Abend des 13. November, er hat die Stadt verändert, er hat die Menschen verändert, er hat die Welt verändert. Wie es weitergeht? Ob Frankreich im kommenden Jahr die Fußballeuropameisterschaft ausrichten kann? Ob wir Reporter in dieser Nacht noch sicher aus dem Stadion und in unsere Hotels kommen? Ich weiß es nicht. Es gibt wichtigere Fragen.
Nachtrag: Um 2.49 Uhr habe ich per Bus und Taxi mein Hotel erreicht. Die Straßen von Paris, die sonst auch in den Nachtstunden noch viel befahren sind, sie waren leer. Und doch war immer wieder Sirenengeheul zu hören. Das Rote Kreuz im Dauereinsatz. „Die Orte, an denen die Anschläge waren, sind alle weiträumig abgesperrt. Da kommt niemand mehr herein“, erklärt mir der Taxifahrer. „Das ist die schrecklichste Nacht meines Lebens“, sagt er dann. „Und es ist noch nicht vorbei.“
Text zwei: „Aber die Liebe ist stärker“
Weinende Menschen, leere Straßen, geschlossene Geschäfte, ein verwaister Eiffelturm, Blumensträuße, letzte Grüße. Paris am Tag danach. Eine Stadt im Schockzustand.
Als Fußballreporter war ich in die französische Hauptstadt gereist, hatte über das deutsche Länderspiel im Stade de France berichten sollen. Nun schreibe ich über Terroranschläge, die die Welt verändert haben.
Um 2.49 Uhr hatte ich in der Nacht zu Samstag endlich mein Hotel im Südwesten der Stadt erreicht. Die Stunden davor, die Stunden danach, ich werde sie nie vergessen.
Die Bomben von Saint-Denis, die Selbstmordattentäter während des Spiels gezündet hatten, sie waren ohrenbetäubend. Nach und nach sickerten auf der Pressetribüne auch die Meldungen von den anderen Anschlagsorten in Paris durch. Fußball? Wer interessierte sich noch für Fußball?
Gegen 0 Uhr hatte ich mich erstmals kurz aus dem Stadion gewagt. Soldaten. An jeder Ecke. Maschinengewehre im Anschlag. Gepanzerte Fahrzeuge. Tränende Augen. Heulende Sirenen. Ohne Unterlass.
Zwei Stunden später gleicht der Weg per Bus und Taxi zunächst einer Geisterfahrt. Die Straßen sind leer. Später aber muss mein Taxifahrer immer wieder an die Seite fahren. Polizei. Krankenwagen. Das Rote Kreuz. „Das ist die schrecklichste Nacht meines Lebens“, sagt der Fahrer. „Und es ist noch nicht vorbei.“
Im französischen Fernsehen berichten drei Sender noch immer live. Sie schalten von Anschlagsort zu Anschlagsort. Verstörende Bilder. Gegen 5 Uhr fallen meine Augen zu.
Der Rezeptionist im Hotel: „Ich vermisse zwei Freunde“
Thomas Dallier (33) ist einer der ersten Menschen, die ich am nächsten Morgen sehe. Er steht an der Rezeption meines Hotels. 18 Stornierungen habe er in den vergangenen zweieinhalb Stunden durchführen müssen. Niemand möchte mehr nach Paris. Und viele, die da sind, wollen nur eines: weg.
Ich verlängere meinen Aufenthalt. Dallier staunt. „Ach ja, sie sind ja Journalist.“
Seine Augen sind klein. „Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen“, sagt er. „Ich vermisse zwei Freunde. Es gibt kein Lebenszeichen.“ Dalliers Stimme stockt.

„Bataclan“, sage ich dem Taxifahrer. „Non“, antwortet er mir. Da könne man doch nicht hinfahren. Alles abgesperrt. Viel zu gefährlich. Kurze Diskussion. Wir fahren los.
„Eiffelturm, Louvre, Notre-Dame, alles dicht“
Und wieder fahre ich durch eine Geisterstadt. Seit Donnerstagmorgen bin ich in Paris. Hektik, Stress, „allez, allez“. Jetzt: Stille. Stille und Sirenen. Die Geschäfte sind verschlossen, die Menschen in ihren Wohnungen. „Euro-Disney ist dicht“, erklärt mir der Taxifahrer. „Der Eiffelturm auch, der Louvre, Notre-Dame, alles dicht.“

Gegen 10.30 Uhr sind wir am Boulevard Voltaire. Hier geht es nur noch zu Fuß weiter. 200 Meter vor dem „Bataclan“, dem Konzerthaus, in dem sich das schrecklichste Blutbad der Nacht abgespielt hat, hat die Polizei die Straße abgesperrt. 100 Reporter haben sich hier versammelt. Sie berichten nach Brasilien, Indien, Australien, Saudi-Arabien, in die USA.
Pierre Koseleff ist kein Journalist. Pierre Koseleff wohnt hier. „Dort, um die Ecke“, deutet er mir auf ein Wohnblock im abgesperrten Gebiet. Die Anschläge, er hat sie hautnah erlebt. „Wir haben erst gedacht, es wäre ein Verrückter, der da rumballert. Dann kamen die Schüsse von allen Seiten.“ Koseleff verschwand vom Fenster. „Später haben sie die Verletzten in ein Restaurant getragen. Eine Frau lag da, es war so unfassbar viel Blut“, berichtet der 51-Jährige. „Ich bin dann zu meinem Bruder gegangen und habe dort geschlafen.“ Koseleff ist Informatiker. Er spricht mit fester Stimme, seine Augen sind klar. „Wir wussten, dass so etwas irgendwann passieren wird“, sagt er mir. „Warum?“, frage ich. „Ich bin Jude, meine Verwandten kommen aus Israel. Ich kenne das Problem.“

Emilien Schultz ist ganz in schwarz gekleidet. Der 28-Jährige unterrichtet Soziologie an der weltberühmten Pariser Uni Sorbonne. Er blickt auf die Menschen vor der Absperrung. „Ich bin überrascht, dass hier mehr Journalisten stehen als Passanten“, sagt er mir. Auch Schultz wohnt direkt ums Eck. „Ich bin sehr besorgt und verwirrt. Ich warte auf die politische Debatte, die nun folgen wird.“ Dann fragt er mich, was er seinen Studenten am Montag sagen solle. „Ich möchte, dass Paris so bleibt, wie es war. Aber dieser Abend war ein Wendepunkt“, sagt er. „Ich fühle mich leer.“

Christina Chirouze (28) ist die erste, die einen Blumenstrauß bringt. Dem brasilianischen Fernsehen gibt sie ein Interview, dann spreche ich mit ihr. „Wir möchten in Solidarität und Frieden zusammenleben und jetzt haben wir hier Krieg“, sagt sie. Ihre Unterlippe zittert. „Aber die Liebe ist stärker.“ Dann geht sie.

Ich auch. Genug für den Moment. Ich muss mich sammeln.
Quer durch die Stadt fahre ich Richtung Élysée-Palast. Polizei, überall Polizei. An jeder Kreuzung haben sich schwer bewaffnete Sicherheitsleute positioniert, alles ist abgeriegelt. Dank meines Presseausweises komme ich in die Sperrzone. Plötzlich Aufregung. Gebrüll. Ein verdächtiges Fahrzeug. Zehn Meter von mir entfernt kommt es zum Stehen. Entwarnung. „C’est bon, c’est bon“, ruft ein Polizist seinen Kollegen zu. Alles okay. Wirklich? Sirenen heulen.

„Das hier ist gerade der sicherste Ort der Welt“, sagt Eric Martin. Der 55-Jährige unterhält sich mit einigen Freunden am Rande der Champs-Élysées. Ihr Thema: der Präsident. Ihre Meinung: François Hollande trage die Schuld an den Anschlägen. „Er hat Bomben auf Syrien werfen lassen. Jetzt haben wir seinen Scheiß-Krieg hier“, sagt Martin. „Und es wird wieder passieren. In sechs Monaten. Spätestens.“ Wut an den Champs-Élysées.
Enorme Polizeipräsenz in der Pariser Innenstadt
Trauer am „Bataclan“. Ich bin zurückgekehrt in den Nordosten der Stadt. Es ist 16.30 Uhr. Paris ist erwacht. Die Zahl der Journalisten, die vor dem Absperrgitter berichten, hat sich in den vergangenen sechs Stunden verdreifacht. Aber jetzt strömen auch die Pariser hierher. Um Abschied zu nehmen.

Dutzende Blumensträuße liegen am Gitter. „Du wolltest einen wunderschönen Abend verbringen“, steht auf einer Karte. „Du wirst nie wiederkehren. Ich kann das nicht glauben.“ Kameras klicken. Stille.
Im Hotel spreche ich noch einmal mit Thomas Dallier. Einer seiner vermissten Freunde ist wieder aufgetaucht. Der andere? „Es gibt keine Nachricht“, sagt er und schüttelt den Kopf. „Niemand weiß etwas. Er heißt Guillaume.“
Text drei: Kinder-Tribüne steht auf dem Schild am Eingang
Das Stade de France. Frankreichs Fußballtempel im Norden von Paris. Zwei Tage nach den Anschlägen, die ich hier, während des Spiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich, erlebt habe, kehre ich zurück an einen Ort, der nur knapp einer noch viel größeren Katastrophe entkommen ist.
Die Gerüchte, ich hatte sie am Samstagnachmittag an den Champs-Élysées vernommen. „Sie waren im Stadion?“, fragte mich ein Passant. „Dann haben sie ja riesiges Glück, dass Sie noch leben. Die Selbstmordattentäter hatten ja Tickets.“
Das „Wall Street Journal“ sollte kurz darauf bestätigen, was ich kaum glauben wollte. Ein Wachmann namens Zouheir hatte der Zeitung bestätigt, dass einer seiner Kollegen einen Mann mit einer Sprengstoffweste am Eingangstor J des Stade de France gestoppt hatte. Wenige Augenblicke später sprengte sich der Attentäter in die Luft. Es lief die 17. Minute des Länderspiels. Die Detonation, ich höre sie noch immer.

39 Stunden später stehe ich wieder hier. Stade de France. Eingangstor J. Schon auf dem Weg hierher hatte ich ein flaues Gefühl im Magen, doch was ich jetzt sehe, lässt mich die Hände vor die Augen schlagen. „Tribune Enfants“ steht auf dem Schild am Eingang. Kinder-Tribüne. „Oh, Gott“, höre ich mich sagen.
Die Überreste eines Attentäters vor dem Stade de France
Hier hatte der erste der drei Attentäter sein gültiges Ticket gescannt, dahinter wurde er abgetastet. Gestoppt.
Der Vorplatz des Stade de France. Ein Sombrero liegt herum. Mülltonnen sind umgestoßen. Wasserflaschen. Plastikbecher. Zwei Wachleute patrouillieren. Die Deutschland-Flagge weht noch. Ein Stadion als Mahnmal.
Ich drehe mich um. Blut. Genau 50 Schritte gehe ich, bis ich vor einer auf dem Bürgersteig getrockneten Lache stehe. Vor einem Sportgeschäft hatte die Flucht des Attentäters geendet. Er zündete.

Die Folgen, sie drehen mir den Magen um. Blut. Überall. In allen Facetten. Auch in acht Metern Höhe hängen Brocken an den Gebäuden. Glibbriges klebt am Boden. „Das ist vom Gehirn“, will mir ein Mann in Jogginghose erklären.

Der Respekt vor den Anschlägen, er ist bei einigen Passanten überschaubar. Zwei Jugendliche mit Baseball-Caps scherzen, einer von ihnen trägt eine DFB-Trainingsjacke. Wie es wohl ausgesehen habe, als es den Körper zerfetzt habe, fragen sie sich. „Boom“, ruft einer der beiden.
Saint-Denis. Plattenbauten. Drogen. Kriminalität. Fast jeder Dritte ist arbeitslos.
Eine Mutter kommt vorbei. Jeden einzelnen Blutfleck will sie mit ihrem Smartphone festhalten. Neben ihr stehen ihre Kinder. Wie alt die seien, frage ich sie. „Drei und fünf.“ Ich wende mich ab.

Shedhu Ghosh (45) wirkt nachdenklicher. Ghosh stammt aus Bangladesch. Er arbeitet als Kellner. Am Freitagabend hatte er bei seinem Cousin in der Wohnung gesessen. „Dann dieser Knall. Alles hat gewackelt. Das war Wahnsinn. Mein Cousin hat sofort gesagt: ‚Das ist eine Bombe.‘ Ich konnte das nicht glauben. Es ist doch alles eine Katastrophe.“

30 Meter weiter fällt mir ein Mann in einem weißen Qamis, einem islamischen Gewand, auf. Glatze. Langer Bart. Er schaut auf die gesprungenen Fensterscheiben, auf ein Loch im Gebäude, auch auf das Blut. Ich nähere mich ihm. Es scheint, als würde er ahnen, was ich ihn fragen möchte. „Das ist nicht der Islam“, sagt er und schüttelt langsam mit dem Kopf. „Das ist nicht der Islam.“
Etwas weiter östlich weist ein Schild auf ein amerikanisches Schnellrestaurant hin. 100 Meter davor aber ist die Straße abgesperrt. Hier haben die anderen beiden Attentäter ihre Bomben gezündet. Vier Tote vor dem Stade de France, darunter drei Terroristen.
Was wäre passiert, wenn dieser eine Wachmann gut 15 Minuten nach Beginn des Spiels nicht wachsam gewesen wäre, wenn er den Attentäter durchgewunken hätte? Was wäre passiert?
Block J. Nordtribüne. Ich zähle die Blöcke, die den Attentäter von mir getrennt hätten. 1, 2, 3, 4, 5. Block U. Pressetribüne.
Das könnte Sie auch interessieren: Er war auch schon im Dschungelcamp: Fußball-Weltmeister versteigert WM-Medaille
Gemeinsam mit dem Mann im weißen Gewand schaue ich zurück zum Stadion. „Tribune Enfants“. Was er über den Wachmann denke, der den Attentäter gestoppt hat? „Héros“, sagt er. Ein Held.

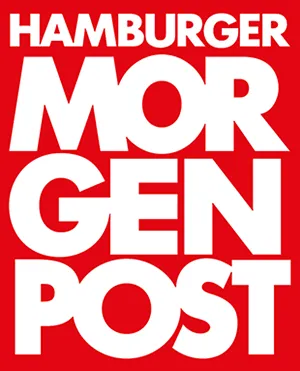

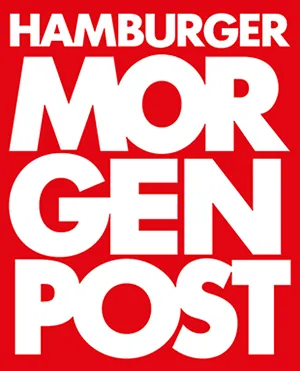
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.